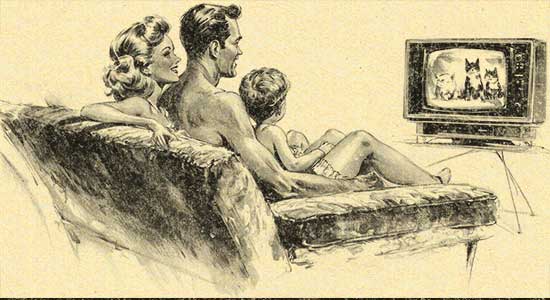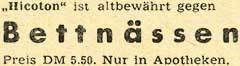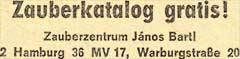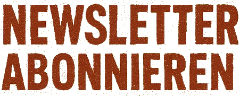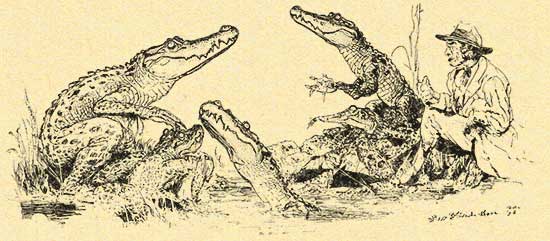

Adler, ich und die Vernichtung der Welt
Die Geschichte von HACKFLEISCH
Ich benötigte die scharfe Knarre, die seit Jahren auf dem Dachboden verstaubte. Pure Sentimentalität hatte bislang verhindert, daß sie auf dem Müll gelandet war. Trotzdem hatte ich schon lange keine Verwendung mehr für die alte Bleispritze. Meine Träume und Wünsche ließen sich nicht mit anachronistischen Hilfsmitteln verwirklichen.
Nun aber schleppte ich den Klopper vier Etagen abwärts und wuchtete ihn auf den Wohnzimmertisch. Zog die Abdeckhaube beiseite und füllte Munition in die Trommel. Dann tippte ich »PUNK MACHT DICKEN SCHWANZ!« in die vorsintflutliche, ungeölte Zeitmaschine. Tack-tack-tack! Klang vielversprechend und ein bißchen nach Steampunk. Jeder Buchstabe mit der Wucht einer Kanonenkugel, ein unüberhörbares Artilleriegeschütz.
Keine Ahnung, was ich damit zusammenschrauben werde, dachte ich. Kein Buch mehr, ok. Aber vielleicht ein neues Punk-Fanzine? Ich erinnerte mich an den Geruch von Druckerschwärze. Roch einwandfrei besser als der Anus von Mark Zuckerkacke.
Ich bekam richtig Bock auf Zukunft.
Zuckerberg hatte ich im Griff, jetzt mußte ich nur noch den Rest der Welt umhauen, Berger inbegriffen. Es war noch lang hin bis zum Schlußgong - der Tanz ging weiter!
Zur Feier des Tages bestellte ich mir bei Smiley’s eine Pizza: Medium Size, Salami, Schinken, doppelt Käse.
»Bitte vorschneiden!«
Während ich auf die Pizza wartete, erinnerte ich mich, wie alles angefangen hatte. Die Schreiberei, HACKFLEISCH, die ersten Abenteuer mit der alten Schreibmaschine.
Ich nutzte die Zeit, jeden Gedanken, der aus mir hervorsprudelte, ins iPhone zu tippen. An die Maschine wagte ich mich noch nicht heran.
Höllenapparate für den lockeren Aufstand
Meine lange zurückliegende Schlacht um die Lufthoheit über deutsche Punk-Stammtische wäre ohne zwei Höllenapparate nie in Gang gekommen. Heute weiß ich, daß ich Stahl, Maschinenöl und nervendem Geratter eine Menge zu verdanken habe.
Ende 1982 lebte ich seit einem halben Jahr in Hannover und arbeitete als Zivildienstleistender im Keller des Krankenhauses Siloah. Dort liefen mir keine Patienten über den Weg.
»Das können wir denen nicht zumuten«, hatte zuvor schon Manowski gesagt. Das war mein Vorgesetzter in Wuppertal, wo mich Papa Staat zunächst ins Petrus-Krankenhaus geschickt hatte. Als mich Manowski tags darauf vom Dienst suspendierte, vermied er jeden Blickkontakt. Wie ein dahingeschissenes Fragezeichen drückte er sich in seinen Bürostuhl. Er verschwand fast hinterm Schreibtisch.
»Diese Frisur … und dazu noch Metallschuhe!«
Die »Metallschuhe« waren Bundeswehrstiefel, die ich mit grünem Metalliclack eingesprüht hatte. Meine Haare standen seifengestärkt in alle Richtungen vom Kopf ab. Die Rückseite der Lederjacke war mit dem Slogan »Ich bin ein Untermensch« bemalt. In Fraktur, der schönsten aller Schriften.
Daß ich während der Dienstzeit nicht Jacke, sondern Kittel trug, hatte nicht geholfen.
Ich ergriff die Gelegenheit und ließ mich nach Hannover versetzen, angeblich eine Punk-Hochburg. Die werden mich aushalten, dachte ich.
Nichts hielt mich in Wuppertal. Meine Freundin war mit einem anderen durchgebrannt, die Bullen versuchten mir wegen der monatlichen Punk-Treffs »Rädelsführerschaft« anzuhängen, und viele der örtlichen Punks und Skins schnüffelten sich das Hirn mit Pattex oder Lösungsmitteln weg. Soffen mit Nazis, randalierten im Kommunikationszentrum »Die Börse« oder lagen bewußtlos davor.
Als in Hannover mein haariges Kunstwerk wegen der häufigen Färberei wegzubröseln begann, rasierte ich mir in einer Mittagspause die erste Glatze meines Lebens. Ich sah nun aus wie ein Skinhead und war doch keiner. Gut, daß 1982 der Durchschnittsbürger nichts wußte von den häßlichen Geschichten rund um die Skins. Da liefen halt jetzt noch so’n paar Punkertypen mehr durch die Gegend, davon einige mit Glatze. Bekloppte eben.
In der hannöverschen Punk-Szene hielt man mich entweder für einen klugschwätzenden Idioten (der noch nicht mal Bier trank, wie bescheuert!) oder für eine Bereicherung. Viele hatten eine Meinung über mich.
Im Dezember 1982 hatte der erste Chaostag keineswegs die hiesigen Punk-Höhlen mit Schutt und Asche zugeschaufelt. Stattdessen schnippelten wir für einige Tage emsig Artikel aus den Zeitungen: SO WÜTETEN DIE PUNKS IN DER INNENSTADT – RANDALIERER WARFEN MIT STEINEN UND BIERFLASCHEN – STRASSENSCHLACHT AM STEINTOR - diese Ausschnitte schmückten bald unsere Zimmer und Butzen.
Leider war nicht jeder Tag ein Chaostag. Der heitere Krieg, der lockere Aufstand, das war die Ausnahme. In der goldenen Zeit des Punk hing ich mit anderen Buntköpfen fast jeden Abend im Unabhängigen Jugendzentrum in der Kornstraße ab, der »Korn«. Nichts passierte. Die meisten tranken wahlweise Bier der Marken Lindener oder Herrenhäuser (»Herri«) und warteten. Ab und an entfachte jemand ein Feuer im Hof und freute sich an den Flammen. Viele kifften. Wenn die Bullen kamen, wurde alles schnell ausgemacht.
Es gab ein Fanzine, das hieß Kornzine. Der Typ, der das Heft fabrizierte, nannte sich Tempo und war der unfähigste Gitarrist der schlechtesten Band der Stadt. Wenn das nicht Punk im Sinne der Erfinder war – was dann?
Tempo war überall und nirgends, nomen est omen. Wie ein Wiesel in Lederjacke tauchte er mal hier, mal dort auf und hinterließ Markierungen, die oft nach Dope rochen. Und er dozierte gerne über die Glocken seiner Freundin und das Ficken allgemein, was nicht so sehr meine Baustelle war. Ich tobte mich auf Papier aus und nicht in nassen Mösen.
Tempo war das keineswegs verborgen geblieben.
»Warum änderst du deinen Namen nicht in Zewa? Zewa wix und weg! Das paßt zu dir. Wir sagen dann allen, daß wir Brüder sind! Zewa und Tempo, klingt doch gut, oder?«
Sein Running Joke, bis zum Erbrechen.
Mein Zimmergenosse war eine alte Adler-Schreibmaschine, die ich auch genau so nannte: Adler! 17 Kilo schwer und mehr Waffe als Werkzeug. Sie stand in meiner 10-Quadratmeter-Zivi-Butze auf dem Boden, gleich neben dem Bett, und wartete auf Einsätze.
Wenn ich mir nicht gerade einen abschüttelte oder an die Decke glotzte, schrieb ich auf dem Metallmonster Texte für die Band, die ich nicht hatte. Tippte den Untergang Hannovers herbei und lieferte den Pogo-Anarchisten eine Begründung für die Wiedereinführung der Todesstrafe.
In den Zimmerchen neben mir lebten Spanier. Sie erledigten die eine oder andere Drecksarbeit im Krankenhaus und konnten kaum Deutsch. Keiner beschwerte sich je über den hackenden Lärm, der oft über den gemeinsamen Flur hallte.
Mein Geschreibsel war mies. Zwar hatte ich bereits unzählige Briefe in die alte Maschine gehämmert und mich als Co-Herausgeber eines Fanzines (»Whistler – Roboter, Reisen, Spekulationen«) der Welt mitgeteilt. Der Name des Heftes entstammte der Perry-Rhodan-Serie – was nicht hieß, daß wir uns auf das Rhodan-Universum beschränkten. Wir wollten »grenzenlos phantasieren«.
Als Autoren wurden jedoch nur Dirk und Jürgen diesem Motto gerecht. Meine Kurzgeschichten hätten sie sicher als »50er-Jahre SF-Schund« belächelt, also zeigte ich nie jemandem eines der Machwerke. Storys, in denen hungrige Außerirdische die halbe Menschheit verspeisten oder der Supermutant Rimbo aus Verzweiflung über seine Einsamkeit den Mond in 1000 Stücke sprengte. Den Traum, eines Tages selbst als Perry-Rhodan-Autor an meiner Lieblingsserie mitzuschreiben, gab ich bald auf.
Stattdessen versuchte ich mich als Kritiker. Ich imitierte den Stil angesagter Szeneschreiber und gefiel mir in der Vorstellung, eines Tages als kenntnisreicher Rezensent angesehen zu werden (»Das müßt ihr lesen … der Typ hat echt Ahnung!«, sollten sie sagen! »Der kennt Worte wie ›Protagonisten‹«!).
Daneben phantasierte ich eine glorreiche Zukunft als Comic-Verleger oder Fantastic-Art-Agent herbei. Erwies sich ebenfalls als Schlag ins Wasser.
Was ich auch unternahm, ich scheiterte daran, und jeder wußte es.
Diese Dinge geschahen vor meiner Punk-Zeit und hatten in einem Debakel geendet. Danach war ich sicher, daß in mir nur ein kleines Licht brannte. Alles, was sich am Horizont abzeichnete, roch nach stumpfer Sklavenarbeit und unerträglicher Langeweile. Ich war ein Nichts ohne einen Funken Talent, ein leerer Trümmerhaufen.
Eines Tages schmiß das Nichts den Job als Industriekaufmann, wurde Punk und begann, seine Untergangsphantasien auszuleben. Aus Peter Altenburg wurde Karl Nagel, und wie Godzilla wollte er ganze Städte unter seinen Doc Martens zertrampeln. Oder gleich die menschliche Zivilisation.
Whistler war zu diesem Zeitpunkt längst Geschichte; ich hatte das Fanzine versenkt, als Dirk für Monate abtauchte und Jürgen mit Nazi-Eskapaden unseren Ruf ruinierte.
Ich stand in den Trümmern meines bisherigen Lebens, und ich genoß es.
Führervisionen und Versagerfrust
Meine Chancen auf ein Leben als menschliche Abrißbirne schienen nicht schlecht: Punk stand im Zentrum des Zeitgeistes, und auch Versager konnten hier eine Menge Wirbel veranstalten. Das war sogar der Kern der Idee dahinter. Mein Scheitern mit Whistler erschien mir geradezu als Qualifikation für eine Karriere als Punkfanzine-Herausgeber. Fantasieren, Sprüchklopfen, Tippen, unbeholfene Grafik und alles zu einem wirren Machwerk vereinen – das konnte ich!
Ja, eine herrlich minderwertige Hymne auf randalierende Verlierer zusammenhacken, das wär’s! Rock ’n’ Roll, »Kultur« und Politik in alle Leibesöffnungen ficken und zu Hackfleisch verarbeiten!
HACKFLEISCH - so sollte der Name des Punk-Fanzines lauten! Ein Heft für Leute wie mich!
Der Gedanke zündete, der Startschuß fiel. Ich hatte kaum Geld und fing auch als Loser klein an, in DIN A 5.
Etwas zwergig für die beabsichtigte Welteroberung, aber HACKFLEISCH sollte alle zwei Wochen erscheinen – das schien mir bei einem Umfang von 12 Seiten machbar. Als Nachrichtenfanzine angelegt, wollte ich mit jeder Ausgabe ein Brikett drauflegen und mein Heft schließlich zum widerwärtigen Spiegel des Punk machen. Und selbst zum Rudolf Augstein der Verdorbenen und Kaputten werden.
Als ich die Nummer 1 kopierte und zusammentackerte, war kurz zuvor mit Pogoflittchen ein neues Fanzine in Hannover aufgetaucht. Mein Timing war schlecht, die Stimmung dennoch gut.
Ich verkaufte ein paar Hefte an Freunde und über den Govi-Plattenladen in der City. Richtig absahnen wollte ich bei einem Konzert in der Korn. Alles voller Punks - perfekte Zielgruppe, lockerer Job! Ich dachte, das würde Spaß machen. Leute kennenlernen und so. Mädchen, vielleicht. Ohne Freundin, schien mir HACKFLEISCH als passendes Werkzeug, auf mich aufmerksam zu machen.
Ich postierte mich am Konzerteingang. Ein HACKFLEISCH in der Hand, die restlichen Hefte in einer Plastiktüte.
»Hey, Alter, willste ’n Fanzine kaufen?«, sprach ich den erstbesten an.
Der Typ mit Herri-Pulle in der Hand und Punquette im Arm blieb stehen und schaute erst mich, dann das Heft an. Nahm es in die Hand, blätterte darin herum. Tat es auf eine Weise, als wollte ihm jemand einen CDU-Prospekt andrehen.
»Gibt’s das umsonst?«
»Nee. 50 Pfennig.«
»Ich nehm eins, wenn du’s mir schenkst.«
»Vergiß es.«
»Du willst dich doch nur wichtig machen. Du und dein Kommerzscheiß.«
Gern hätte ich ihm dafür auf die Fresse gegeben, aber ich wußte, daß meine dünnen Arme nicht für Schlägereien gemacht waren. Also verlegte ich mich auf Agitation, Propaganda und Winselei.
»Komm, Alter … du hast doch auch was davon, wenn Leute in der Szene was machen, oder?«
»Mir doch egal«, sagte der Typ und ließ mich und meine Hefte stehen. Die Freundin des Arschlochs lachte.
Viele lachten und lächelten, andere drohen mir Prügel an. Nach einer halben Stunde steckte ich das Vorzeigeheft zurück in die Tüte und bunkerte den ganzen Scheiß hinter der Theke. Ich hatte keinen Bock auf eine Schlägerei, die ich eh verlieren würde.
Lieber wie die anderen amüsieren!
Die Idee mit dem vierzehntägigen Erscheinen landete bald darauf in der Tonne. Den Rest gab mir eine Aktion, für die im Heft mit einer Anzeige aufgerufen worden war. Tempo hatte selbige für seine Band B-Test gestaltet, und es ging um »Pogo in der Straßenbahn« angesetzt für Samstag, den 29. Januar 1983.
Als ich pünktlich um halb Sieben den Treffpunkt an der Endhaltestelle der Linie 14 erreichte, waren bereits einige Dutzend Punks (plus Hippies und Anarchos) vor Ort.
Meine Freude über die neuentdeckte Zuverlässigkeit von Punks wurde schnell getrübt, als mir der erste Stachelkopf anerkennend auf die Schulter klopfte.
»Geile Aktion, Alter!«, sagte er. »Super organisiert!«
Ich war irritiert. »Nicht von mir. Ich habe nur den Aufruf veröffentlicht.«
»Ach komm … gib’s zu, ich sag’s nicht weiter!«
Er glaubte mir nicht, genausowenig wie viele andere, die mich mit ähnlichen Texten vollquatschten.
Ich war froh, als es losging: Wir stiegen in die Bahn, B-Test sorgte für Krach, die Leute für Lärm, und eine Straßenbahn erlebte Pogo aus erster Hand. Sie schwankte wie ein Fischkutter auf hoher See, als die Stimmung ihren Höhepunkt erreichte. Das Bier floß und spitzte in einem fort.
Eine Viertelstunde später fand der Spaß ein jähes Ende: Zivilbullen prügelten sich durch unsere Reihen, nahmen fünf Leute fest, und anschließend sammelte sich ein Trüppchen um mich.
»Und jetzt, Nagel?«, meinte einer.
»Keine Ahnung.«
»Solltest du aber wissen, wenn du so was aufziehst.«
Mir reichte es, ich ging nach Hause. Ich wollte kein Führer sein, der anderen Entscheidungen abnahm. Und die Lust an der Fanzinemacherei war mir fürs Erste vergangen.
Zwei Monate brauchte ich, um die nächste Ausgabe zu schmieden. Ich packte Adolf Hitler aufs Titelbild und verlegte mich auch im Inneren auf kalkulierte Pöbelei. »Heil Nagel« begrüßte ich meine Leser und verkündete, daß aus dem Nachrichten- ein Ätz-Fanzine geworden war. Ich dachte, einige Spritzer Bosheit würden mich als Führer unattraktiv machen.
Die zweite HACKFLEISCH -Ausgabe festigte dennoch meinen Ruf als Szene-Promi, aber unterm Strich interessierte das Heft kaum jemanden. Vielleicht stand nicht genug über Votzen, Ficken und Pogo drin, wer kann das schon im Nachhinein sagen?
Gerade mal 74 Hefte kamen unter die Leute, und die Hälfte davon verschenkte ich.
Immerhin hatte ich mittlerweile eine Freundin, ich konnte es selbst kaum glauben. Sie nannte sich Climax, ich war Hals über Kopf verliebt in sie.
Climax war vier Jahre älter als ich und besaß eine Plattensammlung, die eine ganze Regalwand füllte. Allerdings verstand sie nicht, daß ich auf Musik stand, die bissig, gemein und grob rüberkam und auch so klingen wollte.
Eines Tages legte Climax Scheiben von Bauhaus und Sex Gang Children auf den Plattenteller.
»Hör dir das an, es geht auch anders«, sagte sie. »Keine Negativkacke – das ist Positive Punk!«
Ich rätselte, was an dem trägen Düstermannsound »positiv« sein, entdeckte aber bald darauf Platten von Black Flag und Bad Brains in ihren Neuzugängen. Eine ganz andere Liga: »Das die Zukunft, nicht deine Depri-Mucke!«, erklärte ich ihr. »Merk dir meine Worte!«
Der neue Sound war schneller und klang härter als der Hardcore-Punk-Sound, den ich aus Deutschland oder England kannte. Die Ami-Sänger schrien sich die Seele aus dem Leib, auf eine Weise, die mir Schauer über den Rücken jagte. Das mußte ich sehen!
Die Bad Brains kamen bald darauf nach Hannover, in die Korn. Das Wasser tropfte von der Decke, als sie auf der Bühne einen Orgasmus nach dem anderen hinlegten. Ich sah pure Magie – bei »Fearless Vampire Killers« schienen die Hände des Sängers Blitze in die Luft zu feuern!
Daß sie als Afro-Amerikaner und Rastas Dreadlocks trugen und ihrem Gott und Kaiser Haile Selassie huldigten, irritierte mich. Genauso wie einige Wochen später der Black-Flag-Sänger Henry Rollins, der mit Parka und langen Haaren durch die Korn schlich. Um eine Viertelstunde später bei »Six Pack« wie eine wütende, muskulöse Kanalratte zu explodieren, so daß alle deutschen und britischen Bands dagegen wie Frührentner erscheinen mußten.
Tatsächlich hatte ich die Vorboten einer neuen Zeit gesehen, aber nichts davon verstanden. In meiner Welt regierte der Punk, wie ich ihn kannte.
Im Sommer 1983 ackerte Adler noch einmal für kurze Zeit im Akkord. Zusammen mit Diva (die machte das Pogoflittchen) fabrizierte ich ein Heft über die diesjährigen Chaostage. Die hatten soeben Hannover zum zweiten Mal erschüttert, und es war klar, daß wir uns über den Verkauf der Hefte nicht den Kopf zerbrechen mußten. Krawall macht Kasse!
Wir hauten auf die Kacke, das Fanzine erschien im A4-Format. Und es sah verdammt schmutzig aus!
Der Retter des Punk
Ein Jahr später, im Sommer 1984: Mein Zivildienst war längst vorbei, blutige Auseinandersetzungen mit Skinheads an der Tagesordnung. Ich ging trotzdem nicht nach Wuppertal zurück. Stattdessen zog ich zu Gift und Lindemann in eine Punk-WG; eine Weile später schaltete Linde punktechnisch einen Gang runter, wurde Taxifahrer und verkaufte mir seine Nietenjacke.
Weil ich ein Superpunkrocker sein wollte, stach ich weitere 200 Nieten hinein und malte in Fraktur – womit sonst? – »Nie wieder Frieden« auf die Jackenrückseite, untermalt von einem Atompilz. Ich gehörte nun zum Stamm der Nietenkaiser. Als Krieger für den Punk!
Zu den dritten Chaostagen lief alles auf ein riesiges, blutiges Gemetzel zwischen Punks und Nazi-Skins hinaus. 2000 Punks aus ganz Europa reisten an, und nach einer kurzen, aber heftigen Auseinandersetzung mit rund 150 Nazis zog sich der bunte Lindwurm aus der City in das Jugendzentrum an der Glocksee zurück. Dort begann eine stundenlange Schlacht mit der Polizei.
Krawallierende Punks zerlegten das Interieur des JZ in Einzelteile und benutzten diese als Wurfgeschosse. Die Plattensammlung eines Sozialarbeiters flog durch ein Fenster auf die Staatsmacht. Auf dem Dach des U-förmigen Gebäudes Vermummte, die mit allem warfen, was hochgereicht wurde. Unten Wasserwerfer, die wegspritzten, was nicht nach Polizei aussah.
Angetrieben von Suff und Drogen, tobte der Mob über das Gelände; einige ältere Punks aus Hannover rannten ziellos durch die bizarre Szenerie. Sie versuchten das Schlimmste zu verhindern. Als ich sah, wie eine hackedichte Punquette auf einen Baum einschlug und rief: »Die Nazis … die Nazis … alle zum Bahnhof!«, reichte es mir. Wie alle anderen, die ihre Sinne beisammenhatten, machte ich, daß ich davonkam und bettelte mich durch eine Polizeikette. Andere klauten ein Kanu aus der Glocksee-Werkstatt und setzen über die Ihme. Leider war das Boot noch nicht fertiggestellt, weshalb es mitsamt der Insassen absoff. Als die klitschnaß das andere Ufer erreichten, wurde ihnen von Schlägern der Borussenfront ein heißer Empfang bereitet.
Bis tief in die Nacht ging die Schlacht an der Glocksee; ich selbst verkroch mich zuhause und wagte nicht an den Tag danach zu denken. Was bloß ist schiefgelaufen?, fragte ich mich.
In den Tagen darauf wußte jeder, daß sich etwas Grundlegendes geändert hatte. Zeitenwende! Als Punk war man nicht mehr Hecht im Karpfenteich. Manche nannten uns nun »Penner mit bunten Haaren«.
Danach war der Großteil der Punkszene mit dem eigenen Niedergang beschäftigt. Die einen lagen besoffen am Straßenrand, andere widmeten sich härterem Stoff und amüsierten über die Alki- und Asi-Punks. Aber nicht lange.
Viele stiegen aus. Als Alternative bot sich Hardcore an, frisch aus Amerika. Andere hatten keine Lust auf einen Kurswechsel und blieben ihrem Punk treu.
Ich bekam es mit der Angst zu tun: War No Future für Punk genau jetzt? Alles vorbei? Niemals – lieber auf Größenwahn umschalten: Ich war der Einzige, der Punk den ursprünglichen Biß zurückgeben konnte, und deshalb mußte HACKFLEISCH aus der Versenkung geholt werden! Was Punk war, bestimmte von nun an Karl Nagel, der Verrückte Denker!
Eines war klar: Nie wieder wollte ich vor irgendwelchen Langweilern auf dem Boden rumrutschen. Die mir eh nur auf die Seiten kotzten. Das neue HACKFLEISCH mußte die Attraktivität eines gut durchbluteten Geschlechtsteils haben! So geil aussehen, daß es jeder haben wollte! Die vielen Buchstaben und Worte würde ich den willigen Käufern als versteckte Füllung eines trojanischen Pferdes unterjubeln. Denn mir lagen ein paar Dinge schwer auf dem Punker-Herzen.
In meinem Kopf prügelten sich die Ideen, bei lauter Marschmusik setzte ich die besten um. Hack! Hack! Hack!
Als Arschloch im Erfolgsrausch
Einige Wochen später spazierte ich mit einem Stapel Papier im Arm über ein Punk-Konzert. Mengele, ein Freund, hatte mich und zwei Kartons HACKFLEISCH in seinem Auto nach Bielefeld mitgenommen.
Die dritte Ausgabe sollte in einer Auflage von 1000 Heften die Punkheit überschwemmen. Volles Risiko, keine halben Sachen mehr! Ich hatte den Drucker überzeugen können, daß er einem Genie gegenüberstand. Dem Schöpfer des besten Punk-Fanzines aller Zeiten!
Der Drucker hieß Lutz Lieber, ein Altlinker, der bei der »Grün-alternativen Liste« (GAL) gestrandet war. Für die saß er im Hannoveraner Stadtrat, um das eine oder andere zu bewegen. Hinter seinen Aktivitäten steckte allerdings nicht wirklich ein »Grüner«, sondern ein gutgelaunter Kommunist mit viel Sympathie für alles, was nach Unruhe und Krawall roch.
Lutz mochte Punks und er mochte anscheinend auch mich, denn er druckte HACKFLEISCH auf Pump. Das fand ich sehr erfreulich. Vielleicht hoffte Lutz aber auch nur, mein Schundheft würde helfen, das System zu zersetzen, den Umsturz zu beschleunigen. Da war Geld natürlich zweitrangig.
Nützlicher für meine Welteroberungspläne war diese mysteriöse elektrische Schreibmaschine, die ich in Lutz’ Büro erspäht hatte. »Kannst deine ganzen Texte drauf tippen, wenn du willst«, sagte er. Natürlich wollte ich, denn das Ding war ein Wunderwerk modernster Technik.
Es hieß »IBM Composer«, und ich staunte die sprichwörtlichen Bauklötze, als ich sah, was es draufhatte: Blocksatz, gestochen scharfes Schriftbild, und man konnte mitten im Text die Schrift wechseln und zum Beispiel einzelne Passagen kursiv setzen! Fucking Moped! So bekamen die HACKFLEISCH-Textfahnen einen echten Zeitschriftenlook.
Wie sein prähistorischer Verwandter Adler schlug der Composer das Gewicht einer E-Gitarre um Längen. Die beiden Stahlgeschütze waren wie für mich geschaffen, denn am Gitarrenspiel war ich Jahre zuvor gescheitert. Das lärmende Schwermetall, das mir stattdessen zur Verfügung stand, sollte von nun an im Dauerfeuer ballern und die Welt vor unseren Superkräften erzittern! Irgendwie. Zusammen waren Adler, der Composer und ich die geilste Band der Welt. Und Lutz ihr Roadie, Techniker und Groupie, alles in einem.
»Was ist mit den Fotos?«, fragte er eines Tages. »Soll ich die rastern?«
Aber so bescheuert war ich nicht, im Gegenteil: Ich kopierte die kleinformatigen Bilder auf Seitengröße hoch, kopierte Kopien von Kopien von Kopien und malte anschließend mit Tusche, Filzstiften und Deckweiß darauf herum. Das Layout sollte ein Schlag in die Fresse sein und keineswegs sauber aussehen!
So kam es, daß ich eine Weile später wieder bei einem Punk-Konzert abhing. Nein, nicht um bei einem »Wir-wollenKrach«-Abend durch die Gegend zu hüpfen. Genau hier und heute startete der Feldversuch, der Lackmustest meines Meisterplans.
Im AJZ Bielefeld spielten ein paar Bands, aber weil es an diesem Samstag für mich nicht um Musik ging, hing ich draußen im Hof ab. Dort redete ich mit Gaga, Andy, Böckchen – wen ich halt so kannte, wer an mir vorbeilief.
Ich sprach niemanden wegen HACKFLEISCH an, aber jeder konnte die Hefte in meinem Arm sehen. Es waren viele, sie waren groß, sie sahen scheißegeil aus! Schluß mit dem verschämten Plastiktüten-Versteckspiel! Das bislang unauffällige A5-Heftchen protzte nun in A4. Auf dem Cover keine Band, kein Adolf, sondern der Größenwahnsinnige Nagel himself! Der Punk-Gott! In einer Pose, die ich einem Marvel-Comic entliehen und selbige dann nachgestellt hatte.
Eine Handvoll HACKFLEISCH im Arm, mit einer Axt zwischen den Beinen – die hatte ich in einem Baumarkt erstanden und ihr den Namen »Anwalt« gegeben – stand ich im Hof des AJZ und wartete auf Opfer. Anwalt in den Laden mit reinzunehmen, war eine leichte Übung gewesen, man kannte sich. Böckchen hatte alles geregelt.
»Was hastn da?«
Eine Punquette, die schon ordentlich einen im Kahn hatte, schaute mich naßforsch aus riesigen Augen an. Über ihrer Stirn wucherte ein giftgrüner Haarberg, auf ihre Jacke war über die volle Breite der Boskops-Schriftzug gemalt. Im Stillen nannte ich sie »Froschkopp«.
Es folgte das übliche Geblätter. Ihr Versuch, Überheblichkeit auszustrahlen, untermalt von einem Schuß Unruhe. Etwas war anders. Ich unterhielt mich weiter mit Gaga und beachtete die Frau kaum. Die Arschloch-Nummer konnte ich auch.
»Was kostet das?«
»Zwei Mark Fuffzig.«
Froschkopp packte ihr Bier zwischen die Knie, zog ein paar Münzen aus der Tasche und gab mir die Kröten. Dafür rückte ich ein Heft raus.
»Viel Spaß!«
Als Mengele und ich gegen Zwei nach Hamburg zurückfuhren, waren 50 Hefte weg. Die ganze Kofferraumladung.
In den nächsten Monaten ging das so weiter. HACKFLEISCH verkaufte sich auch deshalb klasse, weil ich darin Linken und Autonomen vor den Koffer geschissen und das »naturwüchsige Bündnis« zwischen Punks und radikaler Linke öffentlich in Frage gestellt hatte. Die Hannoveraner Polit-Szene wollte wissen, was für ein Buntkopp da auf dicke Hose machte. Es gab einen Sturm im Wasserglas, und von da an hatten mich die Verfechter der Revolution auf dem Kieker. Das sollte sich nie mehr ändern.
Im Laufe der kommenden Wochen trudelten mehr und mehr Briefe von außerhalb ein. Leser wollten HACKFLEISCH zum Weiterverkauf, Händler das Heft in ihr Sortiment aufnehmen. Zum Schluß waren fast 2000 von meinen Meisterwerken weg (Ich mußte nachdrucken, und Lutz bekam sein Geld!). Ohne Werbung, ohne Schleimscheiße – so sollte es sein!
Es folgten zwei weitere Ausgaben in der gleichen Machart, unterbrochen von der Nummer 5, die ich noch mal als kopiertes A5-Heft in Mini-Auflage zusammenschnippelte, um die Sammler zu ärgern. Die gab es nämlich auch schon in den 80ern.
Ende 1986 stand ich mit der sechsten HACKFLEISCH-Ausgabe auf irgendeinem Konzert und zog die bewährte Nummer ab. Im neuen Heft ging es um »Liebe«.
Ein Typ mit Lederjacke, schwarzen Haaren und Nietengürtel taumelte aus der Toilette. Ich erkannte ihn sofort. Es war der gleiche Hohlkopf, der vor Jahren das kleine, süße HACKFLEISCH als »Kommerzscheiß« tituliert hatte. Ihm schien die Begegnung aber längst aus der Birne gerieselt zu sein.
»Ey, Alter … ich will eins!«, sagte er und zog ungefragt Kohle aus der Tasche. »Voll geilomat, was du da machst. Die anderen setzen sich ab … die Straight-Edge-Wixer. Die denken, sie sind was Besseres, weil sie nicht saufen. Aber du hältst die Fahne für Punk hoch … wenn alle abkacken, wirst du der Letzte sein!«
Ich wollte nicht der Letzte sein, der das Licht ausmacht. Und speziell nicht für solche Typen. Für diese Erkenntnis schenkte ich der Blitzbirne das Heft und ging nach Hause.
Danach war Schluß. Kein HACKFLEISCH mehr. Ich ließ mir die Haare wachsen und packte die Nietenjacke in einen Umzugskarton. Es klang nach Langeweile und Tod, sich weiter den Kopf darüber zu zerbrechen, wie der wahre, echte Punk für die Enkel zu bewahren war. Die Nummer war durch.
Ich hatte gecheckt, daß HACKFLEISCH nicht »Leute wie ich« lasen. Die gab es nicht. Oder zumindest nicht dort, wo ich mich herumtrieb. Gab es sie überhaupt irgendwo?
Ein Jahr später wurde Adler durch einen Atari-Computer ersetzt. Es folgte ein PC und dann ein Mac. Adler war zu alt für die neuen Zeiten. Das Ding von vorgestern begann in irgendwelchen Ecken zu verstauben und wurde vergessen.
Die folgenden 30 Jahre interessierte ich mich nicht für Schreibmaschinen und Farbbänder. Stattdessen hatte ich Chaostage, Bands, Pogo-Anarchie und Comic-Produktion auf dem Zettel – alles digital geschmiedet! Am Ende kamen sogar Druck und Papier unter die Räder, der Siegeszug des Internet schien unaufhaltsam.
Bis es klingelte und die Pizza kam.
Phantastereien
2017. Ich wusch mir das Pizzafett von den Händen, ging zurück ins Wohnzimmer. Das Metallmonster blickte mich fragend an. Hast recht, Adler! Genau jetzt war der Zeitpunkt gekommen, den Hebel umzulegen!
Zum ersten Mal seit 30 Jahren ruhten wieder 17 Kilo Stahl und Eisen auf meinem Tisch. Ich versprach mir davon revolutionäre Perspektiven, eine Renaissance fast vergessener Superkräfte.
Ich blickte sie hoffnungsvoll an: die alte Adler-Schreibmaschine, mit der mich schon als Teenager so viel verbunden hatte, daß ich ihr einen Namen gab.
Zugegeben, »Adler« war kein Geniestreich in Sachen Originalität, aber mein Spitzname war auch nicht besser gewesen: »Alti«, von Peter Altenburg. So nannten mich Hinz und Kunz in den 70ern. Adler und Alti, die Kings im Club der vereinigten Raketenfreunde (CDVRF) und später bei Whistler.
Es war allerdings unübersehbar, daß Adler die Arthritis gehörig in den Knochen steckte – er war ja bereits in der 70er ein alter Sack. Damals hatte mir Siggi, der Mann meiner Mutter, den Klopper irgendwoher »organisiert«, wie er mit einem Augenzwinkern zu sagen pflegte.
Und nun war Adler wieder da. Erneut verliebte ich mich in diesen einmaligen Sound: hackedi-fackedi-tack-tack-tack-PLING-rrrömmmp. Die Schreibmaschine war das Denkmal, das mich daran erinnerte, wie betörend HACKFLEISCH war.
Auf Papier, nicht im Internet!
So tippte ich erst langsam und zögerlich, dann immer ungestümer, willkürlich Buchstaben und Worte in die alte Schreibmaschine. Wollte genießen, wie Adler ratterte und tackerte. Sehen, ob irgendwas daraus entstand.
Am besten, ich schriebe auf neun Zentimeter Breite, und falls mein Hirn was Brauchbares ausspucken sollte, konnte ich später das Zusammengetippte zu Textfahnen zurechtschnippeln. Oder reißen. Ritsch-Ratsch.
Das wäre dann echt oldschool gewesen. Und Rohmaterial für ein neues HACKFLEISCH, zusammen mit Bildschnipseln und Fotokopien. Dann alles mit ’nem Pritt-Stift zusammenkleben, die Layouts per Filzstift veredeln, und ab in den Kopierladen!
Während ich mir die Fanzinemacherei in den herrlichsten Farben ausmalte und überlegte, wie ich HACKFLEISCH nach 31 Jahren wiedererwecken konnte, entwickelten meine Finger ohne Vorwarnung ein Eigenleben und tippten Melanie in die Maschine. Ich erstarrte. Was wollte mir das sagen? Ein Wink des Unterbewußtseins? Sollte ich über meine Riesen-Monster-Mega-Flamme schreiben?
Ok, ich fackelte nicht lange, sondern legte los: »Ich schob mir gerade ein Mettbrötchen mit Zwiebeln zwischen die Zähne, als es klingelte. Das konnte nur der DHL-Bote sein, ich erwartete niemanden. Mit dem Brötchen in der Hand wandelte ich zur Tür und öffnete. Mich traf der Blitz, das Brötchen landete auf dem Boden. Ich glaubte nicht, was ich sah: Im Hausflur stand eine Frau in meinem Alter, und sie lächelte mich an. Zwanzig Jahre waren seit unserer letzten Begegnung vergangen, aber ich erkannte im Bruchteil einer Sekunde, wer mir da etwas unsicher in die Augen schaute: Melanie! Ich dachte an die Zwiebeln, die ich soeben …« PLING!
Nein, nicht die zuckersüße Meldung des Zeilenendes war erklungen. Es war das iPhone. Mein sich gerade entwickelnder Gedankenembryo starb den digitalen Tod. Per Twitter war eine Message angelandet, von Berger. Dem war sicher aufgefallen, daß ich meine Facebook-Seite versenkt hatte, und nun kontaktiere er mich auf diese Weise, um den Dingen auf den Grund zu gehen. Wenn ich konsequent sein wollte, mußte ich mein Killerkommando in weitere Einsätze schicken.
Morgen oder so. Dann kommt Twitter aufs Schafott!
Weil morgen aber nicht heute war, brauchte ich genau jetzt eine fixe Lösung.
»Hey Siri, ich will Ruhe haben. Wie schaffe ich das?«
»Wenn du möchtest, schaue ich im Internet nach.«
Mann, die Alte ist dumm wie Schifferscheiße! So hätte es mein Vater ausgedrückt.
In Wahrheit wußte ich genau, was half: Alle elektrischen Geräte mußten aus! Am wichtigsten war, daß ich komplett vom Internet abgeschnitten war. Damit mir nichts und niemand in die Hirnsuppe spucken konnte.
Also einmal quer durch die Bude, klick-klick-klick, alles runterfahren, Stecker ziehen, zum Abschluß ein Schluck Wasser, und dann widmete ich mich erneut Freund Adler.
Das überwältigende Gefühl war immer noch da. Ich schloß die Augen und erinnerte mich an die Fanzines, Briefe und Flyer, die ich auf Adler getippt hatte. An Durchschlagpapier, Fotokopien, Klebeorgien, Filzstifte. Daran, wie meine Hände nach einem Tag Herumschrauberei am Whistler-Triebwerk aussahen: schwarz, mit weißen Klecksen, Klebstoffreste. Die Ingenieurskunst forderte eben ihren Tribut.
Wieder einmal war ich auf Zeitreise, aber eigentlich war es mehr ein ungelenker Mix aus Gegenwart und Vergangenheit. Ich verharrte im Hier und Jetzt. Alles blieb, wie es war.
Man müßte es eher angehen wie Jack Finney in »Das andere Ufer der Zeit«, dachte ich. Ein Roman, in dem die Zeitreise nicht durch hochentwickelte Technik ermöglicht wird, sondern durch Schaffung einer temporären Schnittstelle.
Bei mir hätte das so ausgesehen: Die Bude anmieten, in der ich ’83/84 in einer Punk-WG gewohnt habe. Lichtenbergplatz 4 in Hannover-Linden, knapp 100 Quadratmeter, Parterre. Mein Zimmer exakt so einrichten, wie es damals ausgesehen hat: das Jugendbett mit der grünen Matratze, für den Sound ein Technics Tapedeck RS-M235, dazu Plattenspieler und Boxen. Die Arbeitsplatte, gestützt am linken Ende von einem Bock, am rechten von einem Zeitungsberg. Darauf mein Freund Adler. Ich sitze auf einem unbequemen weißen Stuhl aus Holz, natürlich in Punk-Kluft. Zwar ohne Lederjacke, aber mit Domestos-Jeans und Biene-Maja-Pullover. Schließe die Augen, der Song »Skins und Punks« von den Alliierten dröhnt in meinen Ohren. Tief in mir bin ich davon überzeugt, ja, ich glaube, daß es Oktober 1983 ist. Und als ich das Fenster öffne und auf die Straße springe, sehe ich, wie Gift und Lindemann aus ihrem olivgrünen Mercedes Strich-8er steigen.
»Hey, Nagel, kannste helfen, die Einkäufe reinzuschleppen?«, fragt Gift. Ihr toupierter, roter Haarberg steht genauso perfekt vom Kopf ab wie in meiner Erinnerung, dank Gard Extra Stark. Und Lindemann trägt noch die Nietenjacke, die er mir ein paar Monate später verkaufen wird.
So hätte sich das abgespielt. Wenn die Finney-Methode funktionieren würde. Ich glaubte aber eher nicht daran.
Vollmachen, bitte!
Meine Phantasie lief mittlerweile auf Hochtouren. Allerdings hatte ich bislang nur entschieden, daß ich ein unmögliches Buch in ein locker-leicht zusammengezimmertes Fanzine verwandeln wollte.
Womit ich jedoch das wiederauferstandene HACKFLEISCH füllen konnte, darüber hatte ich noch keinen Gedanken verschwendet.
Ok, auf meiner Festplatte lagerten noch massig Texte, Ideen und Fragmente des Buches, das ich zum Teufel gejagt hatte. Ich fühlte jedoch einen gewissen Ekel, mich daraus zu bedienen. Das Zeugs war kontaminiert, es ging nicht ohne Frischfleisch.
Das wie genau zu züchten war …?
Als ich in den Jahren 1983-86 sechs Pakete HACKFLEISCH über die Theke reichte, mußte ich mir darüber nicht den Kopf zerbrechen. Die Themen lagen auf der Straße, mein Leben als Punk war die Quelle, aus der ich schöpfte. Der Ärger mit Glatzen, Polizei und Polit-Hippies, der konfrontative Alltag ganz allgemein.
31 Jahre später konnte ich nicht einfach dort weitermachen, wo ich 1986 aufgehört hatte, denn die Welt, in der ich einst lebte und aus dem Vollen schöpfte, existierte nicht mehr. Und womit im Jahr 2017 irgendwelche Stachelköpfe und Iroträger ihre Zeit verbrachten, mit wem sie sich prügelten, wen sie haßten oder liebten – davon hatte ich keinen blassen Schimmer mehr, und es interessierte mich auch nicht.
Aber es gab immer noch mein Leben! Das mit Streetpunk mittlerweile herzlich wenig zu tun hatte. Meinen Alltag bestimmten nun Computer, das Internet, die Familie, Schundhefte, das langsame Abwracken eines alternden Glatzkopfs mit streng riechender Zukunft. Ich konnte darüber schreiben, warum ich kein Buch mehr schreiben wollte und weshalb ich das Internet zum Teufel wünschte.
Würde es überhaupt irgendwen interessieren, daß in Hamburg-Bahrenfeld eine trostlose Figur täglich mit dem Kopf gegen die Wand lief? Schwer vorzustellen. Langsam wurde ich sauer. Wieder mal kein Platz für mich, nirgendwo?
Schon klar, auf jemanden wie mich hatte die Welt von heute nicht unbedingt gewartet. Aber Scheiß drauf – es zählte nur, was mir in den Fingern juckte und ans Licht wollte! HACKFLEISCH mußte als Schlachtfest des Punk daherkommen, als völlig überdrehte Mischung aus Erlebtem, Erfundenem und historischer Rückschau! Professor Nagel trifft Klaus Kinski und Philip K. Dick.
Ich spannte ein neues Blatt Papier ein. Ratt-ratt-ratt. Es ging los!